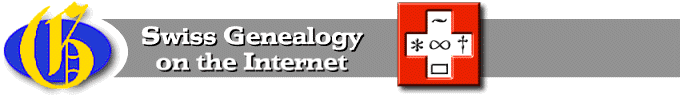
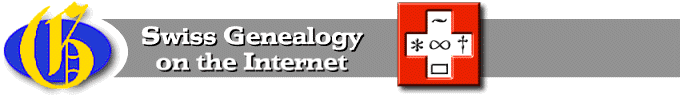
| Familienforschung
Schweiz Généalogie Suisse Genealogia Svizzera |
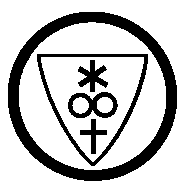 |
| Mitteilungsblatt / Bulletin / Bolletino 70 : September/septembre/settembre 2002 | |
Ungleiche Massstäbe der Kantone beim Erteilen von Forschungsbewilligungen für Genealogen
Sykes, Bryan: Die sieben Töchter Evas (Buchbesprechung)
| Inhaltsverzeichnis / Sommaire | ||||||||||||
| Allgemeines / Généralités | ||||||||||||
| 1 | - | Editorial/Editorial | ||||||||||
| 2 | - | Neue Redaktion / Nouvelle rédaction | ||||||||||
| 5 | - | Impressum | ||||||||||
| 6 | - | Inhaltsverzeichnis / Sommaire / Indice | ||||||||||
| Veranstaltungen der SGFF / Activités de la SSEG | ||||||||||||
| 8 | - | Hauptversammlung 2003 in Schwyz SZ / Assemblée ordinaire 2003 à Schwyz SZ | ||||||||||
| Veranstaltungen der Schweizer Archive / Activités des archives suisses | ||||||||||||
| 8 | - | Tag der offenen Archive / Journée des archives ouvertes | ||||||||||
| Herbstversammlung 2002 / Assemblée d'automne 2002 | ||||||||||||
| 9 | - | Herbstversammlung 2002 | ||||||||||
| 16 | - | Assemblée d'automne 2002 | ||||||||||
| 20 | - | Zugverbindungen / Horaire des trains | ||||||||||
| Fachbeitrag | ||||||||||||
| 22 | - | René Krähenbühl: "Fährtensuche (7)" - Das neue Familiennamenbuch der Schweiz (Artikel erstmals erschienen 1969) | ||||||||||
| Wissenswertes / Rubriques diverses | ||||||||||||
| 45 | - | Aktivitäten der regionalen Gesellschaften / Activités des associations régionales / Attività degli associazioni regionali | ||||||||||
| 53 | - | In eigener Sache - u.a.: Weisungen zur Benutzung der SGFF-Bibliothek für SGFF-Mitglieder | ||||||||||
| 57 | - | Veränderungen im Mitgliederbestand / Mouvement des membres | ||||||||||
| 59 | - | "Dies und Das" - u.a.: Ungleiche Massstäbe der Kantone beim Erteilen von Forschungsbewilligungen für Genealogen | ||||||||||
| 65 | - | Buchbesprechungen von Bibliotheksneuzugängen (SGFF-Bibliothek)
- u.a.:
|
||||||||||
| 75 | - | Zeitschriftenrundschau | ||||||||||
| 79 | - | Leserbrief |
Ungleiche Massstäbe der Kantone beim Erteilen von Forschungsbewilligungen für Genealogen
Sykes, Bryan: Die sieben Töchter Evas.
Warum wir alle von sieben Frauen abstammen - revolutionäre Erkenntnisse der Gen-Forschung.
Aus dem Englischen von Andrea Kamphuis.
Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2001, 335 Seiten, 7 Abbildungen.
Der 1951 in London geborene Bryan Sykes ist Professor für Genetik am Institut für Molekularmedizin der Universität Oxford. Durch seine ausgeprägte Erzählbegabung wird sein Buch lehrreich und vergnüglich. Am überzeugendsten wirken jene der 23 Kapitel, wo er eigene Forschungserlebnisse schildert: "Das Pazifik-Rätsel" und "Der Cheddar-Mann gibt Auskunft". Ein weiterer Vorzug besteht in den wissenschaftsgeschichtlichen Einschüben, die über den Gang der Erkenntnisse dem Leser zum Verständnis verhelfen.
Jeder weiss, dass Kinder ihren Eltern ähneln. Aristoteles vermutete, dass die Gestalt des Ungeborenen einzig auf den Vater zurückgehe. Der mütterliche Beitrag beschränke sich auf die Ernährung des Kindes im Mutterleib und an der Brust. Bei genügender innerer Kochung werde ein Knabe geboren, bei ungenügender Kochung ein Mädchen. Hippokrates glaubte dagegen, die Eigenschaften des Kindes würden durch ein Mischungsverhältnis elterlicher Samenflüssigkeiten festgelegt. Diese Ansicht stimmte mit der Erfahrung besser überein. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Verhältnisse durch gute Mikroskope und Farbstoffe für das Auge sichtbar. Der Kopf eines einzigen Spermiums dringt in die grosse Eizelle ein und erreicht deren Zellkern. Vom Vater und von der Mutter treten gleich viele Fäden aneinander. Da diese sich stark färben liessen, erhielten sie den griechischen Namen Farbkörper, "Chromosomen" (chromos = Farbe, soma = Körper). Man sah, wie sie sich vor jeder Zellteilung in der Mitte der alten Zelle versammelten, spalteten und auf die beiden Tochterzellen verteilten. Die Erbsubstanz stammt somit zu gleichen Teilen von beiden Eltern.
Ein einziges Chromosom des Mannes erschien in zwei verschiedenen Gestalten, X oder Y. Enthielt der männliche Same ein X, so entstand ein Mädchen; enthielt er ein Y, so war von Anfang an ein Knabe festgelegt. Mit einer Auskochung hatte dies nichts zu tun. Jedes Chromosom enthält Querbänder, Gene genannt, die sich als Träger bestimmter Erbanlagen erwiesen, was sich zuerst an der Fruchtfliege Drosophila zeigen liess. Der chemische Aufbau der Chromosomen ist merkwürdig einfach. Nur vier Aminosäuren wechseln ständig miteinander ab. Ihr gemeinsamer Name, Desoxyribonukleinsäure, wird DNS abgekürzt. Heute spricht man von DNA (wegen des englischen Wortes für Säure: "Acid"). Beim Zusammentreten der je 23 väterlichen und mütterlichen Chromosomen im Kern treten häufig Mutationen ein.
Im Januar 1987 eröffnete der Amerikaner Allan Wilson durch einen Fachbeitrag in der Zeitschrift "Nature" ein neues Forschungsfeld: "Mitochondrien-DNA und die menschliche Evolution". Hier geht es nicht um die Chromosomen im Zellkern, sondern um Bestandteile innerhalb der ernährenden Umgebung dieses Kerns. Diese Eizellen-Elemente werden ohne Einfluss des Vaters rein von Mutter zu Mutter vererbt. Trotzdem gibt es auch hier Mutanten, jedoch nur einmal innerhalb von vielen Dutzend Generationen. Wer seine Matura vor über 20 Jahren abgelegt und seither nicht Biologie studiert hat, wird von diesen ovalen, bakteriengrossen, den Stoffwechsel leitenden Einheiten im Zellinnern noch kaum gehört haben. Sie heissen griechisch Fadenknorpel, "Mitochondrien" (mitos = Faden, chondros = Knorpel). Ihre Bedeutung zur Erforschung der Langzeit-Vererbung ist erst seit wenigen Jahren bekannt. Inzwischen hat man viele tausend Frauen auf die DNA-Struktur ihrer Mitochondrien untersucht. Bryan Sykes gehört zu den führenden Analytikern dieses Erbgutes. Eine seiner Folgerungen lautet, dass alle 650 Millionen Europäer von sieben Frauen abstammen, die sich in ihrer mitochondrialen DNA leicht voneinander unterscheiden.
Die Mitochondrien sind nicht nur in die Eizelle, sondern in das Gel (Zytoplasma) aller Zellen eingebettet. Je mehr Beatmung eine Zelle benötigt, um so mehr Mitochondrien braucht sie. Gewebe mit hohem Stoffwechsel (Muskulatur, Nerven, Gehirn) enthalten bis zu tausend Mitochondrien pro Zelle; alle sind von einer Doppelmembran umgeben, und das Wesentliche geschieht auf der inneren Membran. Das befruchtete Ei enthält im Kern gleich viel DNA von väterlicher und mütterlicher Seite, jedoch nur Mitochondrien von der Mutter. Jeder Mann trägt die Mitochondrien seiner Mutter, gibt sie aber nicht an seine Kinder weiter, da deren Mutter dies besorgt. Wenn ein Mann sich überlegt, wessen Mitochondrien ihm eigen sind, so ergibt sich das Spiegelbild des üblichen Stammbaums. Er muss zunächst an die Mutter seiner Grossmutter mütterlicherseits denken und sich entsprechend weiter zurückhangeln.
Die letzte Zarenfamilie der Romanows, die Russland 300 Jahre regiert hatten, wurde 1918 in einem Keller erschossen. 1991 entdeckte ein Geologe in einem Birkenwald im Ural menschliche Gerippe. Die DNA-Sequenz aus den Knochen der Kinder entsprach derjenigen der Mutter. Die des Mannes war anders. Handelte es sich um Nikolaus II.? Man prüfte einen lebenden Blutsverwandten des Zaren, der über eine rein weibliche Ahnenreihe mit ihm verbunden war. Um bei der Frau sicher zu sein, dass sie die Zarin war, ging man entsprechend vor. Der Sohn der Schwester der Zarin, Viktoria von Hessen, ist Prinz Philipp, der Gemahl der englischen Königin. Er spendete Blut, und die DNA-Sequenz stimmte überein.
Alle Goldhamster sind Abkömmlinge eines einzigen Weibchens. Sie haben sich seit 1930 in über 250 Generationen fortgepflanzt. Trotz den Gen-Mutanten haben sich die DNA-Sequenzen ihrer Mitochondrien bei 35 untersuchten heutigen Arten als einheitlich erwiesen.
1990 brach sich Bryan Sykes auf der Insel Rarotonga im südlichen Pazifik die Schulter. Dies zwang ihn zu einem mehrwöchigen Aufenthalt. Es wurde ihm erlaubt, Blutproben aus dem Spital auf die Mitochondrien-DNA zu testen. Ausgedehnte weitere Nachprüfungen bewiesen, dass die Polynesier aus Südostasien stammen, wie es archäologische Funde, Sprachvergleiche, Haustiere und Nutzpflanzen schon lange hatten vermuten lassen.
Bryan Sykes hat seine Bestimmungen auf weit zurückliegende Funde ausgedehnt. Die Radiokarbondatierung ergab für "Ötzi" ein Alter von 5000 bis 5350 Jahren. Aus einer Gewebeprobe ermittelte Sykes seine DNA-Sequenz. Gern hätte er noch ältere Knochen aus dem Jungpaläolithikum untersucht, als der Mensch Jäger und Sammler und noch nicht sesshafter Landwirt war. In der Cheddar-Schlucht, 30 Kilometer westlich von Bath, hatte eine Höhle 1903 das Skelett eines Mannes preisgegeben, der vor 9000 Jahren lebte. Chris Stringer, Abteilungsleiter im Londoner Natural History Museum, grub 1986 in der Cheddar-Höhle einen tadellosen Unterkiefer aus, der sogar über l2000 Jahre alt war. Sykes durfte einen der Zähne anbohren und gewann Pulver zur Bestimmung der Mitochondrien-DNA. Sie entsprach der heute noch verbreitetsten Gruppe.
Er taufte die sieben Urmütter Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrin und Jasmin. Die Berichte über Zeit und Ort ihres Daseins beruhen zwar bloss auf Schätzungen. Doch sind sie abwechslungsreich und reizvoll zu lesen, da der Verfasser sie entscheidende Abschnitte der Menschheitsentwicklung mitgestalten lässt. Lehrkräfte des dritten Schuljahres fänden hier anschauliche Anleitungen.
Für sicher hält Sykes den Ursprung des Homo sapiens in Afrika sowie unsere Abstammung vom Cro-Magnon-Menschen.
Heinz Balmer
[Anm.: weitere Informationen und Links finden Sie auf der Webseite Geschichte und Gene]
Zurück zu Vereinen | Back to Societies | Retour au Sociétés | Ritorno alle pagine delle società
Themenauswahl | Topic Selection | Choix de Thèmes | Argomento