

Kanton St.Gallen (SG) |
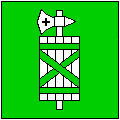 |
Allgemeine
Informationen |
|
St.Gallen liegt im Nordosten der Schweiz, mit direkten Grenzen zu Deutschland (im Bodensee), Österreich und Liechtenstein. Die Kantonshauptstadt heisst ebenfalls St.Gallen.
Die 90 Gemeinden des Kantons sind in 14 Bezirke gegliedert: Übersichtskarte und Liste der Gemeinden
Gesamt-Bevölkerung: 440'744 (einschl. 18.2 % Ausländer)
Bevölkerung der grösseren Ortschaften: sh. Übersichtskarte und Liste der Gemeinden
Sprache: Deutsch
Glaubensbekenntnisse: 60% römisch-katholisch, 33% reformiert
Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren: insgesamt
217'724 (100 %)
- fett: mehr als 5 % / kursiv: mehr
als doppelt des Schweizer Durchschnitts
- Landwirtschaft: 4.15 % (CH total : 3.46 %)
- Forst, Gartenbau: 0.54 (0.61) %
- Energie- und Wasserversorgung, Bergbau: 0.46 (0.69) %
- Nahrungs-, Getränke-, Tabakindustrie: 2.26 (1.73) %
- Textil-, Bekleidungsindustrie, Leder, Schuhe: 4.20 (1.35) %
- Holzbe- und -verarbeitung: 2.39 (1.76) %
- Papier, graphisches Gewerbe: 2.46 (2.19) %
- Chemische Industrie: 1.07 (1.63) %
- Kunsstoff- und Kautschukindustrie: 1.69
(0.57) %
- Abbau und Verarbeitung von Steinen und Erden: 0.88 (0.79) %
- Metallindustrie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik: 12.68 (9.63) %
- Uhren, Bijouterie: 0.07 (0.85) %
- Baugewerbe: 9.49 (8.79) %
- Sonstiges verarbeitendes Gewerbe: 0.53 (0.50) %
- Handel: 16.68 (16.85) %
- Gastgewerbe: 3.89 (4.40) %
- Verkehr, Nachrichtenübermittlung: 5.07 (6.16) %
- Banken, Versicherungen: 10.74 (13.71) %
- Unterrichtswesen, Forschung: 5.17 (5.68) %
- Gesundheitswesen: 4.92 (5.82) %
- Öffentliche Verwaltung: 2.87 (4.34) %
- Übriges Dienstleistungsgewerbe: 3.81 (4.88) %
- Unbekannt: 3.99 (3.63) %
Quelle: Der Kanton St.Gallen in Zahlen 1996/97; Staatskanzlei St.Gallen mit finanzieller Unterstützung durch die St.Gallische Kantonalbank.
Abendländisches Kulturzentrum und Fernhandelsstadt:
Die im W, O und S des Säntismassivs siedelnden Volksstämme
waren romanisiert, als die von N. eindringenden Alemannen in der
2. Hälfte des 1. Jahrtausends die röm.-roman. Kultur
zurückdrängten. Südl. des Churfirsten vermochte sich das
Rätoromanische bis nach 1000 zu halten. Die Germanisierung des
Rheintals war um 1500 abgeschlossen. Im N hatte das beim Grabe
des um 612 eingewanderten irischen Einsiedlers Gallus entstandene
Stift schon bald europ. Bedeutung erlangt. Schenkungen und
Erwerbungen liessen die Fürstabtei St.Gallen im Raum zw.
Bodensee und Zürichsee, aber auch im Donau-, Neckar- und
Schwarzwaldraum zur Grossgrundbesitzerin werden.
Im Hl. Röm. Reich gehörte die Nordostschweiz zum Herzogtum
Schwaben. Mit dem Zerfall der Zentralgewalt bildeten sich auch in
diesem Raum Territorialherrschaften bedeutender Adelsgeschlechter
heraus, so der Grafen von Toggenburg, von Rapperswil, von
Werdenberg-Sargans; die Frhr. von Sax beherrschten um 1200 den
Verkehrüber die Bündner Pässe. Im Spätmittelalter entstanden
eine Reihe von Landstädtchen, die aber alle nicht die Bedeutung
St.Gallens erreichten, das als Ansiedlung von Handwerkern und
Gastwirten (Wallfahrtsort) im 10. Jhdt. in den Mauerring des
Klosters einbezogen wurde. Das Marktrecht St.Gallens geht
mindestens auf 1170, die Reichsfreiheit auf 1180, die Erwähnung
des Rates auf 1312 zurück. Zusammen mit den Appenzellern löste
sich die Bürgerschaft zu Beginn des 15. Jhdts. von der
äbtischen Herrschaft. Seit 1353/54 war St.Gallen Zunftstadt. Im
europ. Leinwandhandel spielte St.Gallen während vier Jhdt. (bis
etwa 1720) eine bedeutende Rolle.
Der Vorstoss der Eidgenossen in die Nordostschweiz:
Fürstabt Ulrich Rösch (1463-91) festigte seine Herrschaft
im "Fürstenland" zw. Wil und Rorschach und erwarb 1468
das Toggenburg. 1451 wurde die Fürstabtei, 1454 die
Stadtrepublik St.Gallen "zugewandter Ort" der
Eidgenossenschaft. Sargans wurde 1483, das Rheintal 1490 durch
Kauf gemeine Herrschaft von sieben eidg. Orten. Glarus kaufte
Werdenberg (1517) und Zürich Sax (1615). Das dazwischenliegende
Gams unterstand seit 1497 Schwyz und Glarus, die seit dem Alten
Zürichkrieg (1443/44) auch Uznach und Gaster besassen. Die
Brückenstadt Rapperswil war seit 1464 dank ihrem Schirmvertrag
mit den drei Urorten und Glarus "zugewandeter Ort" der
Eidgenossenschaft.
Reformation und Gegenreformation (16.-18. Jh.):
Der aus Wildhaus SG stammende Reformator Zwingli wollte von
Zürich aus auch seine Ostschweizer Heimat für die neue Lehre
gewinnen. In St.Gallen waren zwei Laien, der Humanist Vadian
(Joachim von Watt) und Johannes Kessler, die Vorkämpfer der
1524/25 durchgeführten Reformation. Mit Hilfe von Zürich und
Glarus wurde das Kloster aufgehoben. Die meisten Untertanen
wurden reformiert - aber bereits 1531 (nach der Niederlage
Zürichs bei Kappel) wurde die Fürstabtei wiederhergestellt; die
Reformation hielt sich jedoch in der Stadt St.Gallen sowie in
zahlreichen Toggenburger und Rheintaler Gemeinden. Im Frieden von
Baden (1718) erhielt das Toggenburg Religionsfreiheit, während
das Fürstenland dem Fürstabt untertänig blieb.
Von den ersten
Befreiungsbewegungen bis zur Helvetik:
1723 vermochte der Werdenberger Landhandel die Glarner
Herrschaft (noch) nicht zu erschüttern. Die erste Auflehnung
erfolgte 1793 in Gossau SG ("Zall nünt, du bist nünt
scholdig"), wo der Bote "Bott" J. Künzle die
unwürdige Stellung der "Fürstenländer" mit den
freien Appenzellern verglich. Abt Beda Angehrn kam im
"Gütlichen Vertrag" (1795) den Forderungen entgegen,
starb aber bald danach. Da sein Nachfolger, Abt Pankraz Forster,
dem Volk keine Rechte abtreten wollte, erklärte sein Landvogt
Karl Müller-Friedberg die Toggenburger von sich aus für frei
(1798). Nach dem Einmarsch der Franzosen (1798) konstituierten
sich nach dem Vorbild Appenzells und der Innerschweiz acht
Landsgemeinderepubliken. Diese Zwergstaaten wichen jedoch nach
wenigen Wochen dem Einheitsstaat der Helvetik. Eine willkürliche
Grenze teilte das Gebiet von SG, AI, AR, GL sowie Teilen von SZ
auf die beiden Neukantone Säntis und Linth auf.
Die Gründung des Kantons 1803:
Am 19.2.1803 überreichte Napoleon in Paris einer helvet.
Consulta seine Mediationsakte, welche die 13 alten Orte
wiederherstellte und ihnen 6 neue Kantone anfügte, darunter den
Ringkanton St.Gallen. Diese künstliche Schöpfung umfasste, was
von den helvetischen Kantonen Säntis und Linth nach der
Wiederherstellung der beiden Appenzell sowie GL und der
Wiederangliederung der March an Schwyz übrigblieb.
Offizielle Webseite "200 Jahre Kanton
St.Gallen" mit Kurzfassung der neuen Kantonsgeschichte
in 9 Bänden.
Artikelserie von Markus Kaiser im St.Galler
Tagblatt, basierend auf der reich
bebilderten Broschüre "Es
werde St.Gallen":
1.
Am Anfang stand Napoleon: Den Franzosen sei Dank.
2.
Chaos in der Helvetischen Republik: Vom Bürgerkrieg zur Entsendung von Deputierten nach Paris.
3.
Arbeit und Vergnügen in Paris: St.Galler Abgesandte zu Napoleon beordert.
4.
Es werde St.Gallen: Napoleon schafft den Kanton St.Gallen.
5.
Napoleons Mediation für die Schweiz: Die Übergabe der Verfassung.
6.
Die Geburtsstunde des Kantons: Die erste Zusammenkunft des Grossen Rates.
Von der Mediation zur Restauration und zur Regeneration:
Weil Abt Pankraz Forster den neuen Freistaat nicht anerkennen
wollte, hob der (mehrheitlich katholische) Grosse Rat das über
tausendjährige Stift im Mai 1805 endgültig auf. Aus dem 1823
entstandenen Doppelbistum Chur-St.Gallen ging 1847 das
eigenständige Bistum St.Gallen hervor.
Das Staatsoberhaupt (Müller-Friedberg) verkannte später die
Zeichen der Zeit (Julirevolution 1830). Die Regenerationsbewegung
unter dem Rheintaler Handwerkerssohn G.J. Baumgartner erreichte
1831 eine neue Verfassung (Gewaltentrennung, allgemeines und
direktes Wahlrecht ohne Rücksicht auf Vermögensbesitz). Eine
Zeit der Wirtschaftsblüte brach an : anstelle der
Leinwandproduktion traten Baumwollindustrie und Stickerei. 1847
war St.Gallen der "Schicksalskanton", der in der
eidgenössischen Pattsituation die Entscheidung zur Auflösung
des Sonderbundes ermöglichte.
Die Entwicklung seit 1848:
Der Freistaat St.Gallen nahm die Bundesverfassung von 1848
mit Zweidrittelsmehrheit an. In der
"Ausgleichsverfassung" von 1861übernahm der Staat das
bisher den Konfessionen überlassene Erziehungswesen. Die heute
(1996) gültige Verfassung
geht auf die Verfassung von 1890 zurück; in der Teilrevision von
1911 wurde das Verhältniswahlrecht eingeführt.
Die wirtschaftliche Entwicklung wurde vom Eisenbahnbau
(1856-1910) sowie der Rheinregulierung (1923) geprägt. Um 1900
war St.Gallen das Weltzentrum der Stickerei : der Ausfuhrwert der
St.Galler Stickereien übertraf jenen der gesamtschweizerischen
Uhren- und Maschinenexporte ! Dementsprechend wirkte sich die
Stickereikrise der Zwischenkriegszeit empfindlich aus, leitete
aber auch eine Strukturveränderung ein : Maschinen- und
Apparatebau, später die Herstellung von Kunststoffen sorgten
für neue industrielle Schwerpunkte.
Stark gekürzt nach Schweizer Lexikon, Verlag Schweizer Lexikon, Horw 1991-93
Ostschweizer (Familien-) Geschichte aktuell
Die regionale genealogische Vereinigung ist
GENEALOGISCH-HERALDISCHE GESELLSCHAFT OSTSCHWEIZ
Bei genealogischen Fragen bzgl. des Kantons St.Gallen können Sie sich wenden an :
Bedenken Sie bitte, dass alle hier genannten Familienforscher
Ihren Fragen nur in der Freizeit nachgehen können.
==> Bitte, haben Sie deswegen etwas Geduld bzgl. einer Antwort
auf Ihre Frage ! <==
Weiter sind Sie eingeladen, im Genealogieforum St.Gallen Ihre Fragen mit anderen Forscherinnen und Forschern zu diskutieren, die ebenfalls im Kanton St.Gallen forschen. Das Archiv ist für Gäste frei zugänglich; um antworten oder ein neues Thema starten zu können, ist jedoch eine (kostenlose) Registrierung erforderlich. Beim Schreiben ist zu beachten, dass nur Fragen zum Kanton St.Gallen hier erscheinen sollten; für Fragen zu anderen Regionen wechseln Sie bitte zum entsprechenden Kanton oder zum allgemeinen Genealogieforum Schweiz.
Die kantonale historische Vereinigung ist
HISTORISCHER VEREIN DES KANTONS
ST.GALLEN
Ebenfalls mit der Geschichte des Kantons St.Gallen befasst
sich der
VEREIN FÜR
DIE GESCHICHTE DES BODENSEES UND SEINER UMGEBUNG
|
 Besuchen Sie den Barocksaal der Stiftsbibliothek (ein Klick auf das Bild zeigt einen grösseren Ausschnitt) .... |
 ... und verpassen Sie auf keinen Fall den Besuch in der "virtuellen Stiftsbibliothek"! |
Register der Bibliotheken und Archive im Kanton St.Gallen.
1. Offizielle Seite des Kantons
2. Seiten des Verkehrsvereins und Ähnliches:
3. Private Seiten zum Kanton :
2. Quellen
Die Kirchenbücher des Kantons St.Gallen.
Die Jahrzeitbücher in den katholischen Pfarreien des Kantons St.Gallen.
Familienforschung
auf den Seiten der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
(Namensindex Bürgerbuch 2000)
Familien-Register der evangelischen Gemeinde Wildhaus
Kirchenbücher der katholischen Gemeinde Wittenbach
Genealogien von Wartau (zusammengestellt von Jakob Kuratli)
Fäh Johann: Zur Geschlechterkunde des Gasters
Fremde Ehen in Uznach SG (1612 - 1822)
Die 14 alten Widnauer Bürgergeschlechter
Stiftsarchiv St.Gallen: genealogische Quellen
Quellen zur Emigration aus dem Kanton St.Gallen
Stadtarchiv St.Gallen (Vadiana): Ämterarchiv (Bücher)
Die Gründungszeit des Kantons St.Gallen in den Protokollen des Bezirksarztes Falk im Distrikt Gossau
Biographische Daten zum Orts-/Regionalverkehr der Ostschweiz
Archiv von Fritz Müller, Bürger von Waldstatt AR und Fischenthal ZH
Buchreihe "St.Galler Kultur und Geschichte"
Neujahrsblätter des
Historischen Vereins des Kantons St.Gallen
Personen-Register der Totentafeln der Neujahrsblätter des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen
Aktuelle Publikationen zu St.Gallen und der Schweiz
Bibliographie zu Ulrich Bräker (1735-1798)
Auswanderungsgeschichten aus dem Gasterland
Ostschweizer (Familien-) Geschichte aktuell
Mediengeschichte des Kantons St.Gallen mit Hinweisen auf auch genealogisch interessante Periodika.
Archiv für Frauen- und Geschlechtergeschichte Ostschweiz
St.Leonhardstr. 63
CH - 9000 St.Gallen
Tel. und Fax: +41 71 222 99 64
e-mail: frauenarchiv.ostschweiz@bluewin.ch
Kantonsauswahl | Canton selection | selection des Cantons | selezione del Cantoni
Themenauswahl | Topic Selection | Choix de Thèmes | Argomento